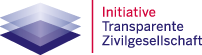Empathie im Luftschutzkeller
Der mitdiskutierende Psychoanalytiker vertrat die Meinung, es würde bald wieder alles in alten Bahnen laufen, für eine tiefgreifende Veränderung sei die Zeit zu kurz, so schnell lerne der Mensch nicht, seine erworbenen Verhaltensweisen zu verändern. Ich kann euch etwas darüber erzählen.
Als 1939 der 2. Weltkrieg begann, war ich neun Jahre alt. Zunächst änderte sich nicht viel in meinem Leben. Mein Vater wurde nicht gleich eingezogen, es gab nicht sofort Lebensmittelkarten, und auch an Luftangriffe war noch nicht zu denken. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich Berlin einmal verlassen müsste. Die Schule lief weiter wie immer, ich flitzte mit Roller und Rollschuhen durch Friedenau und spielte mit den Jungs aus dem Haus auf dem Hof: Mit Kreide wurde eine Autobahn auf das Pflaster gemalt, und mit Spielrennautos wurden Autorennen nachgestellt, nachdem verlost worden war, wer Rosemeyer oder von Brauchitsch sein durfte. An den Wochenenden fuhr ich mit meinen Eltern im Paddelboot über den Kleinen und Großen Wannsee.
1943 begann sich das zu ändern: die Luftangriffe der Royal Air Force wurden häufiger und zerstörerischer, und ich verbrachte mehr Nächte mit der Hausgemeinschaft im Luftschutzkeller. Einige der Leute, die in unserem Haus in der Rheinstraße wohnten, kannte ich besser, andere nicht so gut. Wahrscheinlich ging es den Erwachsenen am Anfang genauso: einige unterhielten sich angeregt, andere sprachen kaum miteinander. Aber alle lauschten nervös auf die Geräusche der Flakkanonen und der herabrauschenden Bomben. Wenn man sie hört, treffen sie einen nicht, hieß es. Ob das stimmte?
1943 wurden die Schulen geschlossen und die Kinder und Jugendlichen mussten die schwer bombardierten Städte verlassen, fuhren entweder zu Verwandten nach Schlesien oder Ostpreußen oder in Kinderlandverschickungsheime im Osten des Landes, die noch nicht von Bombardierungen betroffen waren.
Mein Vater wurde zur Marine eingezogen, und ich fuhr mit meiner Mutter und mit meinem kleinen Bruder nach Masuren, der Heimat meiner Großmutter. Etwas über ein Jahr lebten wir dort, meine Mutter mit meinem Bruder in einem kleinen Dorf am Ufer des Großen Selmentsees bei einer entfernten Tante, ich in Lyck, wo ich zur Schule ging und in einer Schülerpension wohnte.
Im Sommer 1944 rückte die Ostfront näher, die deutschen Truppen mussten sich westwärts zurückziehen und die Lage wurde brenzlig. Die Situation war für uns Bombenflüchtlinge aus dem Westen und Süden Deutschlands einfacher als für die einheimischen Ostpreußen und Schlesier, wir verloren unsere Heimat nicht und konnten uns in den Zug setzen und wieder nach Hause fahren. Das machten wir dann auch. Es hieß zwar, jeder würde wieder in seine Heimatstadt zurücktransportiert, man müsse nur noch ein bisschen abwarten; andererseits gingen aber auch Gerüchte um, man würde als Berliner oder Münchener, Kölner gar nicht nach Hause gebracht, sondern in irgendwelche thüringischen oder sächsischen Dörfer verfrachtet. „Das hat mir gerade noch gefehlt“, sagte meine Mutter und kaufte Fahrkarten nach Berlin. Auf dem Weg nach Hause besuchten wir noch Verwandte in Königsberg und wären dort um ein Haar in die russische Eroberung der Stadt hineingeraten.
Im Juli 1944 kam ich also wieder zu Hause in meinem geliebten Berlin an. Ich hatte sehr viel Heimweh gehabt und war froh, wieder zu Hause zu sein, trotz der Luftangriffe, die es jetzt viel häufiger gab als vorher. Viel war in Friedenau in der Zwischenzeit nicht zerstört worden. Am meisten fiel das große Haus Rheinstraße Ecke Kaiser(Bundes)allee auf, das in Trümmern lag, so dass ich jetzt von unserem Küchenfenster aus die Schloßstraße entlang sehen konnte. Auch die Atmosphäre im Luftschutzkeller hatte sich verändert, die Menschen waren sich näher gekommen. Unsere Nachbarn, ein älteres Ehepaar, die erst kaum mit jemandem sprachen, hatten ihre Schüchternheit verloren, zwischen anderen waren Freundschaften entstanden. Man duzte sich, half den Älteren, bei Alarm die Koffer in den Keller zu schaffen, in denen jeder seine wichtigsten Habseligkeiten nach unten schaffte, damit man, sollte man ausgebombt werden und noch am Leben sein, das Nötigste rettete.
Was war das für eine Freude, als wir wieder da waren! Wir wurden sozusagen mit offenen Armen empfangen. Hänschen und sein Bruder Werner, mit denen ich vorher Autorennen gespielt hatte, ließen sich von mir meine masurischen Erlebnisse erzählen. Mir gefielen diese Offenheit und Nähe, die da entstanden waren. Die Nachbarn, die sonst immer etwas an mir auszusetzen gehabt hatten, sahen jetzt großzügig über meine große Klappe hinweg, mit der ich mich gegen ihre Ablehnung geschützt hatte. Kannst du nicht etwas leiser auf der Treppe sein, hieß es jetzt freundlich, während ich sonst immer angeschnauzt worden war: Ruhe im Hausflur, ungezogene Göre! Gemeinsam half man sich über die Ängste vor den Bomben hinweg, später über die vor den Russen. Wir wohnten im 4. Stock, und die Frauen des Hauses kamen zu uns und versteckten sich unter den Betten oder hinter den Schränken, wenn russische Soldaten ins Haus kamen. So hoch steigen die nicht, wurde gemunkelt; aber sicher war sicher.
Irgendwann war das alles vorbei. Langsam lief wieder ein normales Leben an, und jeder zog sich in seinen eigenen Bereich zurück. Hin und wieder trank man noch eine Tasse Kaffee zusammen und plauderte: Wissen Sie noch, wie wir damals...? Aber auch das verebbte langsam. Auch vier, fünf Jahre gemeinsamen Erlebens und Erleidens schwerer Zeit reichten nicht aus, um eingefahrene Verhaltensweisen zu verändern.
Veranstaltungen
- Samstag, 27. April 2024 11:00 - 14:00 "IntoDance" Tanzworkshops für Menschen mit körperlichen Einschränkungen
- Sonntag, 28. April 2024 16:00 - 17:00 RostSchwung: Umweltgeflüster*
- Montag, 29. April 2024 10:00 - 11:30 Kontaktgruppe für ältere, alleinstehende Menschen
- Montag, 29. April 2024 11:00 - 16:00 Offenes Café für Nachbarinnen und Nachbarn
- Montag, 29. April 2024 14:00 - 17:00 Allgemeine Sozialberatung, Unterstützung bei der Wohnungssuche und psychosoziale Beratung für Geflüchtete
- Dienstag, 30. April 2024 18:00 - 19:30 Sprach-Café- مقهى اللغة
- Donnerstag, 02. Mai 2024 14:00 - 18:00 Technikcafé